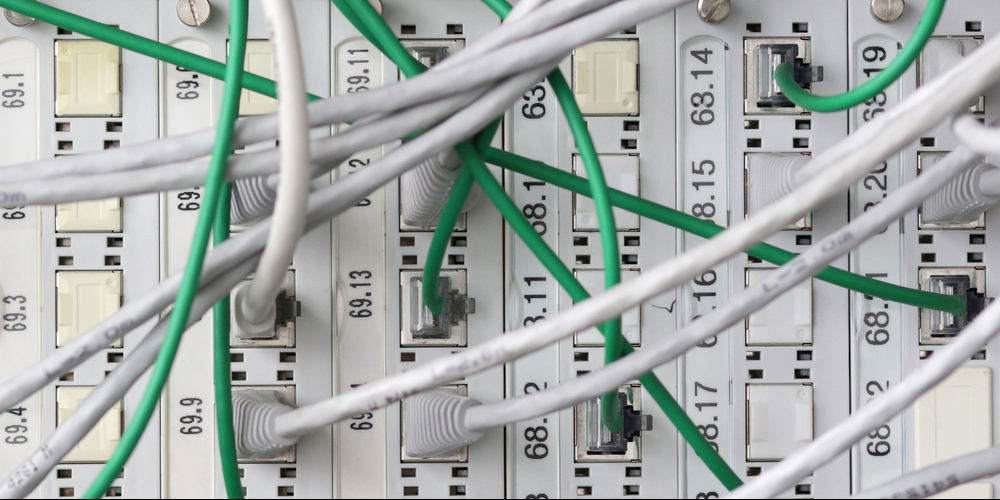- Tobias Hoffmann
Aber dass die Universität und der Kanton Zürich in diesem Bereich eine ziemlich einzigartige Initiative am Laufen haben, ist noch nicht allzu bekannt.
Im Januar ging die Meldung ein, die Universität Zürich (UZH) schaffe sieben neue Digital-Professuren. Diese Expansion ist, so war zu erfahren, die dritte Phase einer 2016 gestarteten, gross angelegten Forschungsinitiative der UZH namens Digital Society Initiative (DSI). Ein Ziel ist es, 36 Professuren zu Fragestellungen der digitalen Transformation zu schaffen. Seit 2020 mischt auch noch, so stand weiter, die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) mit, an der sämtliche kantonalen Hochschulen (neben der Uni die ZHAW, die ZHdK und die PHZH) beteiligt sind. Wenn Ihnen nun etwas schwindlig wird vor lauter Digitaldies und Digitaldas – es ging mir gleich.
Da es sich um eine grosse Sache zu handeln scheint, sollte man aber etwas mehr darüber wissen. Deshalb auf zu Markus Christen, dem Geschäftsleiter der DSI, der als Forscher Spezialist für digitale Ethik und Cybersicherheit ist. In den Räumlichkeiten der DSI in einem Unigebäude an der Rämistrasse 69 klärt er mich über die Zusammenhänge auf. Doch die feinen Verästelungen hochschulpolitischer Strukturen und Vorgänge lassen wir hier beiseite und beschränken uns aufs Wesentliche.
Von der Chirurgie bis zur Theologie
Die DSI ist, so Christen, eine «spezielle Einheit» der Universität. Mitglied können aber auch Forschende von ausserhalb werden. Zurzeit zählt die DSI etwas über 1000 Mitglieder. Die DIZH hingegen ist eine einfache Gesellschaft der vier kantonalen Zürcher Hochschulen, die gemäss Kantonsratsbeschluss vom 20. Januar 2020 zusätzliche Mittel von 108 Millionen Franken verteilt. Die DIZH ist ein «Forschungscluster», bei dem jede Hochschule einen vorher definierten Anteil erhält. Ein wesentliches Ziel ist, dass die Hochschulen enger zusammenarbeiten.
Aber was hat es nun mit der digitalen Transformation auf sich? Christen definiert sie so: «Man bildet viele Lebensprozesse auf ein digitales Informationssystem ab. Das bedeutet, dass beinahe alles, was man macht, aufgezeichnet werden kann.» Das heisst nichts anderes, als dass sich sozusagen für alle Bereiche unseres Lebens Fragen der digitalen Informationsverarbeitung ergeben. So ist denn auch die Breite der Themen, die im Rahmen der DSI behandelt werden, beeindruckend. Jede Fakultät der UZH ist eingebunden. Es gibt Professuren zur interaktiven visuellen Datenanalyse, zur computergestützten Chirurgie, zum maschinellen Lernen, zur Computerlinguistik, zu digitalisierten Kommunikationsräumen, zum Thema Digitalisierung und Religion bzw. Theologie, zur Arbeitsgeografie, zum Mobilitäts- und digitalen Innovationsmanagement sowie anderem mehr.
Keine hierarchischen Entscheide
Christen erklärt, dass bei der DSI ein Bottom-up-Prinzip praktiziert werde, eine Planung, die nicht von Entscheiden «von oben», also hierarchisch, geprägt ist: Die gut 1000 beteiligten Forscher bilden Communitys, die für von ihnen ausgearbeitete Projekte um eine Finanzierung anfragen können. Dieses Jahr hat sich zum Beispiel eine Community gebildet, die zur Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung forschen möchte. Beteiligt sind Leute verschiedener Disziplinen und verschiedener Stufen – vom Doktoranden bis zum Professor.
Ausserdem sei Bildung ein wichtiges Thema, ergänzt Christen. Früher sei Latein die Wissenschaftssprache gewesen, die alle hätten können müssen. Heute könnte man sagen: Alle müssen ein bisschen Digitalisierung können. Im Rahmen der DSI wird erprobt, wie den Studierenden diese Basis am besten zu vermitteln ist, und es werden dafür Programme entwickelt. Es ist Teil des Auftrags der DSI-Professuren, die Studierenden im Rahmen dieser Programme zu unterrichten.
Aber bei diesem etwas abstrakten Überblick soll es nicht bleiben. Im Folgenden werden eine Forscherin und zwei Forscher mit aktuellen oder kürzlich abgeschlossenen Projekten vorgestellt. Markus Christen hat die drei vorgeschlagen und dabei ein gutes Gespür für Themen von breitem öffentlichem Interesse gezeigt. Und so erfahren wir einiges über Hassrede im Netz, mit einseitigen Daten gefütterte künstliche Intelligenz und die Chancen und Risiken von Fitnesstrackern.