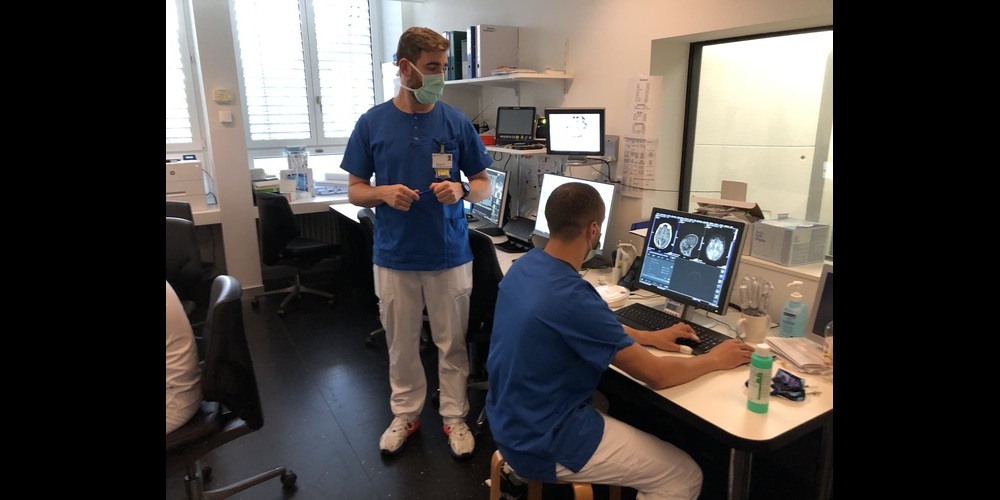Vertiefendes Interview mit PD Dr. med. Thi Dan Linh Nguyen-Kim
(Das Interview wurde schriftlich geführt. Die Fragen stellte Tobias Hoffmann.)
Frau Nguyen-Kim, das Institut, das Sie ab dem 1. Januar 2023 leiten werden, nennt sich «Institut für Radiologie und Nuklearmedizin». Was haben die beiden Bereiche miteinander zu tun?
Sowohl die Radiologie als auch die Nuklearmedizin sind bildgebende Fachbereiche und eng miteinander verwandt, auch wenn sich die zugrunde liegende Technik unterscheidet. Aus diesem Grund sind die beiden Fachbereiche im Stadtspital Zürich innerhalb einer Abteilung vereint. Auch in anderen Häusern sind das oft keine getrennten Abteilungen.
Bei der Nuklearmedizin denkt man wohl zuallererst an die berüchtigten «Bestrahlungen» bei Krebserkrankungen.
Bestrahlungen werden in der Radioonkologie/Strahlentherapie durchgeführt und nicht in der Nuklearmedizin. Die Nuklearmedizin ist ein diagnostisches und therapeutisches Fach. In der diagnostischen Nuklearmedizin geht es darum, durch die Beobachtung des Stoffwechsels in Echtzeit Erkrankungen und Funktionsstörungen nachzuweisen und das Ansprechen auf die Behandlungen zu beobachten. Das geschieht, indem für die Erkrankung oder den Stoffwechsel des betroffenen Organs spezifische Biomoleküle schwach radioaktiv markiert werden und deren Verhalten im Körper mit den Geräten der Nuklearmediziner beobachtet und in Bildern dargestellt wird. Dies geht für alle Organsysteme von Kopf bis Fuss, zum Beispiel zur Demenzabklärung des Gehirns, bei Schilddrüsenfunktionsstörungen, bei Erkrankungen der Herzkranzgefässe und bei vielen Krebserkrankungen. Die therapeutische Nuklearmedizin nutzt das gleiche Prinzip, um therapeutisch wirksame radioaktive Substanzen gezielt an den Ort der Krankheiten zu bringen und selektiv zu behandeln und dabei das umliegende gesunde Gewebe soweit wie möglich zu schonen. Klassische Beispiele sind die Behandlung von gut- und bösartigen Schilddrüsenerkrankungen, entzündliche Gelenkserkrankungen und schmerzhafte Knochenmetastasen von bestimmten Krebsarten. Ich bin überzeugt, dass in Zukunft die therapeutische Nuklearmedizin bei der gezielten Behandlung von Krebserkrankungen eine immer grössere Rolle spielen wird.
Ich habe selbst als Patient schon sowohl ein MRT, ein CT wie auch einen Ultraschall erlebt. Was sind die Stärken und Möglichkeiten der verschiedenen Verfahren, und wann kommen sie zum Einsatz?
Bei den bildgebenden Verfahren kann man generell unterscheiden zwischen Untersuchungstechniken ohne Verwendung von Röntgenstrahlen wie die Ultraschalluntersuchung und die Magnetresonanztomographie (MRT) sowie solche unter Verwendung von Röntgenstrahlen, die beim klassischen Röntgenbild und bei der Computertomographie (CT) zur Anwendung kommen. Die Ultraschalluntersuchung hat einen besonderen Stellenwert in der Diagnostik von inneren Organen, insbesondere bei Kindern, sowie auch bei schwangeren Patientinnen. Die Hauptanwendung des klassischen Röntgenbildes findet sich auch heutzutage auf dem Notfall, um etwa eine Fraktur auszuschliessen. Der Vorteil von CT und MRT ist, dass man überlagerungsfreie Schichtbilder erzeugen und dadurch ein ganzes 3-D-Volumen beurteilen kann. Die CT-Bildgebung ist die bevorzugte Untersuchung im Notfall, da schneller. Die MRT dauert etwas länger und ist somit weniger für den Notfall geeignet, wird aber mehr für die Differenzierung unklarer Befunde angewandt, da man hier die Weichteilstrukturen besser beurteilen kann.
Ist Radiologie immer eine eher zudienende Disziplin, oder übernimmt sie manchmal auch die Hauptrolle?
Die moderne Radiologie ist heutzutage Bildgebung, um bei der Diagnostik zu helfen und hat zudem eine wichtige Rolle bei der sogenannten Interventionellen Radiologie. Anhand konventioneller radiologischer minimalinvasiver Verfahren kann die*der interventionelle Radiolog*in die akute behandlungsbedürftige Pathologie sowohl darstellen und sofort therapeutisch behandeln, ein Beispiel hierfür sind akute periphere Gefässverschlüsse oder akute Blutungen. Die Interventionelle Radiologie hat eine zunehmend tragende Rolle in der minimalinvasiven Behandlung, sei es bei der minimalinvasiven therapeutischen Schmerztherapie oder der gezielten lokalisierten Behandlung von Tumoren oder Metastasen bei Krebspatient*innen. Im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin des Stadtspitals Zürich wird beides unter einem Dach angeboten: Diagnostik und Therapie.
Ihre besondere Expertise liegt offenbar bei der «onkologischen Bildgebung» und der «Thoraxradiologie». Können Sie uns erklären, was die Besonderheiten dieser Bereiche sind?
In beiden Subdisziplinen geht es insbesondere um exakte Mustererkennung des radiologischen Bildes. Diese ist essenziell für die exakte Diagnose und von besonderer Bedeutung auch in der Beurteilung eines Tumors im Verlauf unter Therapie, insbesondere im Falle neuer Immuntherapien. Bei der Lunge geht es beispielsweise um die frühzeitige Erkennung von möglichen fibrotischen Lungengerüstveränderungen und um Strukturveränderungen im Lungenparenchym unter der Therapie. Es ist zu betonen, dass neben der fachlichen Expertise sowohl in der Thoraxradiologie als auch in der onkologischen Bildgebung ein wichtiges Fundament die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen wie der Onkologie, Pneumologie, Chirurgie und Pathologie ist. Dieser wertvolle Austausch wird im Stadtspital Zürich tagtäglich gelebt.
Sie waren noch im März dieses Jahr Oberärztin am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsspital Zürich. Auf den 1. April sind Sie zur Leiterin der Radiologie am Stadtspital Waid berufen worden und nun bereits zur Chefärztin Radiologie und Nuklearmedizin des gesamten Stadtspitals. Wie verändert dieser schnelle Aufstieg Ihr Aufgabengebiet?
In meiner langjährigen Tätigkeit als Oberärztin im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsspital Zürich (USZ) habe ich mehrere Leitende Funktionen von Bedeutung ausgeübt. Besonders hervorzuheben ist meine Leitung der Task Force für das radiologische Assessment des Therapieansprechens von Krebspatient*innen. Meine Arbeitsgruppe betreute über 100 interdisziplinäre onkologische Studien. Im Rahmen meiner Führungstätigkeit war ich direkt verantwortlich für Personal, Finanzen und Vertragswesen. Mein Team garantierte in enger Kollaboration mit dem Institut für Nuklearmedizin am USZ eine hohe fachliche Dienstleistungsqualität für die Behandlung von Krebspatient*innen.
Meine klinische Laufbahn ist geprägt durch einen grossen interdisziplinären Austausch. Dabei ist es mir wichtig, nachhaltige Arbeitsprozesse zur Zufriedenheit der Zuweisenden zu etablieren bei gleichzeitiger Erhaltung höchster fachlicher Qualität zur Sicherstellung eines exzellenten Versorgungsniveaus zum Wohle der Patient*innen.
In meiner Position als Chefärztin und Standortleiterin des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin des Stadtspitals Zürich am Standort Waid habe ich grosse Freude in der Zusammenarbeit mit meinem Team im klinischen Alltag, wobei mir eine umfassende Einsicht auf allen Ebenen der Dienstleistung, über bestehende Organisationsabläufe sowohl im Routinebetrieb und im Notfallbetrieb wichtig ist. Dabei ist mir ein achtsamer, respektvoller und wertschätzender Umgang mit meinen Mitarbeitenden und der nachhaltige kollegiale Umgang mit den übrigen Fachdisziplinen sehr wichtig.
Welchen Herausforderungen sehen Sie in Ihrer neuen Funktion in den nächsten Jahren entgegen? Welche Veränderungen in der Radiologie erwarten Sie für die kommende Zeit?
Die bereits stattfindenden Entwicklungen innerhalb als auch ausserhalb der Schweiz zeigen, dass in der Radiologie die Arbeit im Netzwerk mit verschiedenen Standorten die Zukunft ist. Dadurch können Synergien im Sinne des betriebswirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen innerhalb des Netzwerkes optimal genutzt und gefördert werden. Ziel des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin des Stadtspitals Zürich mit zwei Standorten ist der Service am Patienten durch schnelle Termine und durch Ausbau des Angebotsspektrums. Im Sommer dieses Jahres wurde das neue PET/CT am Triemli in Betrieb genommen, neue Geräte werden im Laufe des nächsten Jahres hinzukommen, darunter ein zweites CT-Gerät am Waid. Das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin ist ein wichtiger Partner innerhalb des zertifizierten Tumorzentrums des Stadtspitals Zürich und wird sein Angebot innerhalb der Subspezialisierungen verstärkt ausbauen, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie.